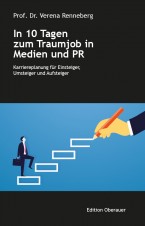Düsseldorf/Salzburg - Hersch Fischler, Jahrgang 1947, arbeitet seit den 1980er Jahren als freier Journalist und Rechercheur. Fischler, im österreichischen Steyer geboren, wohnt heute in Düsseldorf. Er wirft den bekannten Journalisten Hans Leyendecker, Klaus Ott und Nicolas Richter vor, bei ihren Recherchen die journalistische Sorgfaltspflicht massiv verletzt zu haben. Die drei Journalisten der "Süddeutschen Zeitung" hatten den Henri-Nannen-Preis abgelehnt, weil sie den Preis mit zwei Autoren der "Bild"-Zeitung hätten teilen müssen. Fischler geht auch mit Ines Pohl, Chefredakteurin der alternativen Berliner "taz" hart ins Gericht und spricht über seine eigene Arbeit.
Herr Fischler, Sie haben Ende November 1997 Dokumente entdeckt, die bewiesen, was mit dem SS-Raubgold passiert ist. Was genau war das für eine Recherche?

Hersch Fischler.
Hersch Fischler: "Es war eine spannende journalistische Recherche, noch fast ohne Internet, aber mit vielen Telefonaten. Damals stellte der World Jewish Congress (WJC) große Forderungen an die Schweiz, und es wurde von verschiedenen seiner Repräsentanten behauptet, hunderte Tonnen von Gold, das von Juden in Ghettos und KZ geraubt worden war, seien als Goldbarren umgeschmolzen in die Safes Schweizer Banken gelangt und lägen wahrscheinlich noch dort. Aber es wurden keine Beweise präsentiert. Als ich beim WJC nachfragte, hieß es, die Goldbücher der Reichsbank, an welche die SS das Gold lieferte, seien bei Kriegsende vernichtet worden, von den Russen erobert, jedenfalls nicht mehr greifbar. Ähnliche Auskünfte erhielt ich von Instituten und Historikern, die in der Presse sich zu Wort gemeldet hatten."
Was haben Sie dann getan?
Hersch Fischler: "Ich las die wissenschaftliche Literatur zu dem Thema und fand im Vorwort des Buches eines amerikanischen Historikers in einer Nebenbemerkung, allerdings ohne Quellenangabe, die Amerikaner hätten die Goldbücher der Reichsbank erobert und bald nach dem Krieg der Bank Deutscher Länder übergeben, aus der dann 1957 die Deutsche Bundesbank hervorging. Vom historischen Archiv der Bundesbank erhielt ich die Auskunft, man habe die Goldbücher der Reichsbank nicht und wisse nichts über den Verbleib. Ein Anruf bei dem amerikanischen Historiker, einem sehr alten Professor, ergab, dass er sich der Quelle nicht mehr erinnern konnte, jedenfalls Akten der amerikanischen Militärverwaltung in Germany seien es gewesen. Ich fuhr ins Bundesarchiv Koblenz und informierte mich dort über die Mikrofiches. Dank der Findbücher und Hilfe der Archivare hatte ich nach zwei Tagen die Liste mit allen eroberten Reichsbankgoldbüchern, Verfilmungsprotokolle und Übergabeprotokolle an die Bank Deutscher Länder gefunden und kopiert. Ich hatte "Stern", "Spiegel", "Zeit" und "Süddeutsche" schon meine Recherchen angeboten, die zeigten kein Interesse. Ich fuhr dann mit dem englischen Journalisten Peter Bild zur Bundesbank und konfrontierte dort Pressesprecher und Archivar mit der 50 Jahre alten Stückliste und dem Übergabeprotokoll. Wie war die Reaktion?
Hersch Fischler: "Die waren sehr erschrocken, aber auch sehr kooperativ. Eine interne Suche ergab, dass eine Hand voll wenig bedeutsame Reichsbank-Goldbücher noch im Archiv lagen, aber alle anderen nicht mehr vorhanden waren. Peter Bild publizierte die Story im "Telegraph", wenige Wochen später tauchten die Mikrofilme der Reichsbankbücher in Washington auf. Kopien gingen an die Bundesbank und dort durfte ich diese Filme dann hinsichtlich der Mengen und Wege des SS-Raubgoldes auswerten. Ich bekam dann auch von der Schweizer Bergier-Kommission gegen Widerstände anderer Wissenschaftler den Auftrag eine Expertise über Mengen, Wege und Verbleib des SS Raubgoldes anzufertigen, deren Ergebnisse im Wesentlichen auch in den deren späteren Abschlussbericht eingingen."
Sie haben dann im Archiv der Bundesbank einen interessanten Fund gemacht!
Hersch Fischler: "Ja, die Recherche wurde erst dadurch richtig spannend, als ich im Archiv der Bundesbank eine unglaublich präzise private Denkschrift über den Verbleib des nach Deutschland verschleppten italienischen Staatsgoldes der Banca d'Italia fand. Ein Wiener Kaufmann namens Herbert Herzog war schon in den fünfziger Jahren ins Archiv der Bank Deutscher Länder hineingekommen und hatte die Goldbücher der Reichsbank zumindest hinsichtlich des verschleppten italienischen Staatsgoldes ausgewertet. Ich begann nach Herbert Herzog in Wien zu suchen und konnte ihn nicht mehr finden. Ich rief Wiener Medien und Journalisten an, um mehr über Herbert Herzog zu erfahren und Kooperationspartner für die Recherche zu Herbert Herzog zu suchen."
Sie hatten Glück, haben Hubertus Czernin erreicht, den ehemaligen Chefredakteur von "Profil" in Wien.
Hersch Fischler: "Als ich Hubertus Czernin anrief, muss bei ihm mehr geklingelt haben als nur das Telefon. Er lud mich für den "Standard", für den er damals schrieb, nach Wien ein. Herbert Herzog war ein Abenteurer und Geschäftsmann gewesen, der "Profil" in den Gründungsjahren mit besten Informationen und Enthüllungsrecherchen versorgte, aber schon in den siebziger Jahren verstorben war. Dass er aber auch Millionen damit verdient hatte, in dem er der Banca d´Italia half, den Verbleib ihres großen Goldschatzes zu dokumentieren und diesen wieder zu erhalten, hatte niemand bei "Profil" gewusst. Zusammen mit Gabriele Anderl und dem SWR-Report, die ich auch für die Herzog-Recherche gewinnen konnte, fanden wir dann die letzte Lebensgefährtin von Herbert Herzog, zwanzig Jahre nach seinem Tod immer noch erstaunlich jung und attraktiv."
Ein Glücksfall!
Hersch Fischler: "Sie hatte die geschäftlichen Dokumente von Herbert Herzog zwar nicht mehr, erinnerte sich aber an eine große Filmdose, die ihr Herbert Herzog mit der Bitte, gut auf sie aufzupassen, übergeben hatte. Diese Filmdose hatte sie noch."
Was verbarg sich in der Filmdose?
Hersch Fischler: "Sie enthielt Mikrofilmaufnahmen von Reichsbank-Goldbüchern - und einer besonderen Auswertung. Diese hatte der Chef der Reichsbankgoldabteilung und späteren Gold-Abteilung der Bank deutscher Länder kurz nach dem Krieg für die Amerikaner angefertigt: über Wege, Mengen und Verbleib der Reichsbank-Goldbarren, insbesondere auch der Goldbarren, welche die Degussa nach dem Einschmelzen des SS-Raubgoldes an die Reichsbank zurückgeliefert hatte. Die Ergebnisse waren die gleichen, die ich schon mit meiner Analyse der amerikanischen Filme der Goldbücher für die Bergier-Kommission geliefert hatte. Die Mengen des SS-Raubgoldes waren nur ein Bruchteil von dem, den die Propagandisten des WJC genannt und zurückgefordert hatten, weniger als fünf Tonnen statt Hunderte von Tonnen. Und diese immer noch hunderte zählenden großen Goldbarren waren bis auf drei nicht an Schweizer Banken gegangen, sondern an die Deutsche Bank, Dresdner Bank, Commerzbank und eine italienische Bank. Das alles liegt schon 15 Jahre zurück."
Wie waren damals die Reaktionen auf Ihre Ergebnisse? Welche Resonanz haben Sie erhalten?
Hersch Fischler: "Das Interesse der Medien war sehr groß, weltweit, vor allem wegen der geheimnisvoll erscheinenden Wiener Mikrofilme, ein Hauch von Dritter Mann und so. Die deutschen Großbanken wurden als Täter oder zumindest Sünder angeprangert. Dabei hatte ich nie behauptet, und es gab auch keinen glatten Beweis dafür, dass die Großbanken seinerzeit gewusst hatten, dass die Goldbarren aus SS Raubgoldlieferungen stammten. Die drei Großbanken setzten drei historische Kommissionen ein, die letztlich meine Analysen bestätigten."
Welchen Einfluss hatten die Entdeckungen für Ihre berufliche Laufbahn?
Hersch Fischler: "Für mich beruflich entwickelte sich die Recherche als eher sehr schädlich. Ich hatte Fakten ans Licht gebracht, die die wichtigsten damaligen Akteure verärgerten. Der WJC war über die Bloßstellung seiner Übertreibungen sauer und unterstützte die Degussa darin, mich von ihrem Archiv auszuschließen. Die drei Großbanken wollten mich in ihren Historikerkommissionen nicht haben, die beauftragten Historiker sowieso nicht. Ich stellte zu viele Fragen und recherchierte auch auf eigene Faust weiter. Die Bergier-Kommission war sauer. Sie war von Politikern eingesetzt worden. Die wollten, dass die Schweizer Banken den WJC Entschädigung zahlten, nicht der Staat. Da kamen meine die Banken doch in wichtigen Punkten entlastenden Ergebnisse ungelegen. Wenn ich nicht publizierte, wollte man meinen Auftrag anscheinend in Hinblick auf laufende Verhandlungen lukrativ verlängern. Dem stimmte ich nicht zu, zumal ich auch mit Journalisten in Wien die Herbert-Herzog-Story und Dokumente gefunden hatte. In der Bundesbank freute man sich über meine Recherchen auch nicht gerade, da die Reichsbank-Goldbücher erst in den Anfangszeiten des Bundesbank-Archivs verschwunden waren. Im US-Außenministerium fand man meine Recherchen nicht so toll, weil sie zeigten, dass die Amerikaner in den Anfangszeiten des Kalten Krieges SS-Raubgold nach politischen Gesichtspunkten restituierten. Da die Italiener damals kommunistisch zu werden drohten, bekamen sie keines zurück, erst später, als ihnen Herbert Herzog dabei half. Bald war das Medieninteresse vorbei und der SWR hatte keine Lust, sich mit Ignatz Bubis anzulegen, der beim WJC für das Thema in Deutschland zuständig war. Die SWR-Berichterstattung und geplanten weiteren Recherchen wurden mir zu ängstlich und einseitig und ich verabschiedete mich. Am fairsten behandelte das Bundesarchiv die Story. Es hatte von der Bundesregierung den Auftrag erhalten, das Verschwinden der Gold-Bücher in der Bundesbank zu untersuchen. Es informierte mich, nahm alle meine Fragen auf und erstellte einen umfangreichen Bericht. Das Verschwinden der Goldbücher in den Anfangszeiten des Bundesbankarchivs konnte es auch nicht aufklären, aber es wurden durch seine Recherchen dort doch noch Lieferscheine der SS an die Reichsbank über Gold aus Konzentrationslagern gefunden, die anfangs übersehen worden waren. Tieferes Interesse an meinen Recherchen zeigte aus den Medien nur einer: Hans Leyendecker. Er gratulierte, berichtete häufiger über sie und stieß sogar ein Porträt in der SZ über mich an. Aber eine Finanzierung für weitere Recherchen brachte das auch nicht, und das Thema Raubgold interessierte mich nicht besonders.
Wie sind Sie auf das Thema eigentlich aufmerksam geworden?
Hersch Fischler: "Ich recherchierte damals zu einem anderen Thema - zum Kriminalisten Walter Zirpins, der die ersten und umfassendsten Geständnisprotokolle Marinus van der Lubbes über seine Rolle bei der Reichstagsbrandstiftung aufgesetzt hatte. Ich hatte an Hand von Akten des Bundesarchivs festgestellt, dass er ein falsches Geständnis van der Lubbes über seine Alleintäterschaft protokolliert, vor dem Reichsgericht falsch darüber ausgesagt und andere Täter geschützt hatte. Nach dem Krieg machte er trotzdem wieder große Karriere und wurde Informant vom "Spiegel" und der Hauptzeuge für die Enthüllung vom "Spiegel" der Alleintäterschaft Marinus van der Lubbes. In den Jahren 1940 und 1941 leitete Zirpins als Spezialist für Unterschlagungsdelikte den Goldraub im Lodzer Ghetto, damit nicht allzu viel Gold in den Taschen der Kriminalisten und SS verschwand und noch etwas bei der Reichsbank abgeliefert wurde. Deshalb interessierte ich mich für die Goldbücher der Reichsbank, um vielleicht seine Ergebnisse rekonstruieren zu können. Deshalb forschte ich so hartnäckig nach, als ich las, dass es sie doch noch geben musste. Sonst hätte ich mir gesagt, na ja ein Widerspruch. Aber die Profis des Themas werden ihn vor dir aufklären, vergeude keine Zeit. Dass etablierte Historiker und bei Verlagen und Institutionen angestellte Historiker und Journalisten brisanten Widersprüchen oft nicht nachgehen, weil es Ärger bringt oder Aufträge und Karriere kosten kann, ahnte ich damals vielleicht schon, lernte es aber erst richtig verstehen, nachdem ich die Recherche durchgezogen hatte."
Waren Sie stolz, dass gleich drei unterschiedliche Historikerkommissionen Ihre Ergebnisse überprüfen mussten und zum gleichen Ergebnis kamen?
Hersch Fischler: "Anfangs vielleicht, aber nicht sehr lange. Was hatte ich schon davon? Dass ich bei den Kommissionen nicht hinzugezogen wurde stempelte mich ja zum Außenseiter, mit dem man besser nicht zusammenarbeitete. Das wiederholte sich dann später bei der Bertelsmann-Recherche."
Wie und wann haben Sie Hans Leyendecker kennengelernt?
Hersch Fischler: "Nachdem meine SS-Raubgold-Recherche solch einen Erfolg hatte, rief mich Hans Leyendecker, vielleicht als neuen Informanten oder Kollegen häufiger an, dann lud er mich 1998 zu einem langem Besuch nach Leichlingen ein, kochte sogar etwas für mich und wir sprachen ausführlich über unsere Erfahrungen. Er erzählte mir, im "Spiegel" habe er sich halten können, solange Rudolf Augstein noch halbwegs präsent war. Augstein schützte ihn vor internen Angriffen und sicherte ihm für seine Recherchen und Berichte Rechtsschutz ohne Kostenbegrenzung bis zum BGH zu. Er war auch nicht unkritisch gegenüber den "Spiegel", es seien dort schlimme Fehler passiert, aber als Mitarbeiter hätte man fast nichts dagegen machen können und letztlich könne man nur das schreiben, was die Verleger lesen wollen. Unsere Kontakte wurden mit der Zeit lockerer, blieben aber auch nach meiner Bertelsmann-Recherche freundlich."
Was passierte dann?
Hersch Fischler: "Alles änderte sich schlagartig, als ich im November 2000 die Ludwig-Börne-Preis-Verleihung an Rudolf Augstein für aufklärerischen Journalismus kritisierte. In der Schweizer "Weltwoche" hatte ich mit einem Beitrag mit meinem Co-Autor Holger Becker an Augsteins entscheidender Rolle bei der Etablierung der von dem Verfassungsschutzbeamten Fritz Tobias entwickelten Alleintäterlegende erinnert. Die Preisverleihung wurde zunächst abgesetzt. Der Sponsor des Preises, ein damals in der Schweiz tätiger deutscher Bankier, forderte in der "Süddeutschen Zeitung" den "Spiegel" auf, die Alleintäterthese und die Rolle von SS-Offizieren in der Frühzeit des "Spiegels" noch einmal zu überprüfen."
Wie reagierte Hans Leyendecker? Er war damals ja schon bei der "Süddeutschen Zeitung"!
Hersch Fischler: "Ihm gefiel das überhaupt nicht. Auf einmal mochte er mich nicht mehr und wollte mich als Moderator nicht mehr zu Worte kommen lassen, zum Beispiel bei einer Podiumsdiskussion in Düsseldorf. Der "Spiegel" korrigierte seine Alleintäterthese in einer neuen Reichstagsbrandstory nicht und nahm nur kosmetische Änderungen vor. Augstein erhielt den Börne-Preis in der halbleeren Paulskirche dann doch noch und ließ danach die Plakatsäulen der Republik mit großen Hitler- und Dritte-Reich-Titelseiten zupflastern. Der Platzhirsch der Zeitgeschichte markierte beleidigt sein Revier. Fortan war Leyendecker auf mich überhaupt nicht mehr gut zu sprechen. Er machte mich als Verschwörungstheoretiker madig und verhinderte, wo er konnte, dass meine "Spiegel"-Kritik an der angeblich größten investigativen Leistung des "Spiegels" in Sachen Reichstagsbrand, wie es Peter Merseburger genannt hatte, diskutiert wurde. Auch dann noch, als das Institut für Zeitgeschichte die Kritik von mir an der Alleintäterthese des "Spiegel" publizierte und seine jahrelange "wissenschaftliche" Bestätigung der Alleintäterthese zurückzog. Sogar beim "Netzwerk Recherche", das ja angeblich die Förderung und Qualitätssicherung des investigativen Journalismus zum Ziel hat, verhinderte er, dass ich bei der Fact-Checking-Konferenz 2010 im Spiegel-Gebäude einen Workshop zu Fehlern des "Spiegels" beim Fact-Checking seiner Reichstagsbrand-Enthüllungsserie und deren erneuter Bestätigung 2001 durch den "Spiegel"-Historiker Klaus Wiegrefe machen konnte, ebenso auch bei der Konferenz "Tunnelblick - Gescheiterte Recherchen" im Jahre 2011."
Sie haben in der vergangenen Woche schwere Vorwürfe gegen die Journalisten Leyendecker, Ott und Richter von der "Süddeutschen Zeitung" erhoben. Kollegen halten Sie für einen "Nestbeschmutzer". Was sagen Sie denen? Ärgert Sie das?
Hersch Fischler: Wie sollte es? Der Vorwurf der Nestbeschmutzung hat sich doch seit den sechziger Jahren unglaublich abgenutzt. Warum sollen gerade Journalisten nicht vor der eigenen Tür kehren, wo sie doch in fast allen Bereichen von Politik, Wirtschaft und Gesellschaft für mehr Sauberkeit sorgen wollen?
Wie kommt es, dass die Jury und die Preisstifter des Henri-Nannen-Preises, der Verlag "Gruner und Jahr" sowie das Magazin "Stern", nicht offiziell auf Ihre Vorwürfe reagieren?
Hersch Fischler: Weder offiziell noch inoffiziell, ich habe seit jetzt fast drei Wochen nichts mehr gehört. Mindestens drei Jury-Mitglieder, die Chefredakteure von "Stern", "Spiegel" und "Focus", haben eigene bedeutende Fact-Checking-Abteilungen. Warum haben Sie mein Fact-Checking und meine Kritik an den SZ-Artikeln und den Jurybegründungen nicht zerpflückt, wenn es falsch ist? Da sind wohl mehr als eine Handvoll Pressekönige und -kaiser auf großer Bühne nackt in neuen Kleidern erwischt worden, und hoffen, dass mein schwaches Stimmchen überhört wird und die mit ihnen geschäftlich verbandelte Medienelite sich nicht traut, sich zu empören oder Fragen zu stellen.
Glauben Sie tatsächlich, dass die Jury darauf verzichten würde, die Wahrheit zu suchen und zu veröffentlichen?
Hersch Fischler: "Mit der Jury war da ein eingespieltes Oligopol auf der Bühne, das fast den gesamten so genannten Qualitätsjournalismus der Bundesrepublik kontrolliert. Bei den Chefredakteuren von "Spiegel", "Stern" und "Zeit" und "Welt" wundert mich das Schweigen nicht, ihre Medien sind alle auf die Alleintäterthese zum Reichstagsbrand hereingefallen und wollen mir keine Glaubwürdigkeit zusprechen, die meiner Kritik am Versagen ihrer Zeitgeschichtler nur glaubwürdiger machen könnte. Bei Springer freut man sich zudem über die imagefördernde Auszeichnung zum 60. Geburtstag der "Bild" und will die Juryleistung deshalb ganz bestimmt nicht in Frage stellen. Über Helmut Markwort wundere ich mich in letzter Zeit immer mehr. Den Vogel schießt allerdings Ines Pohl ab. Erweist sie sich tatsächlich als größte Blindgängerin von allen? Nachdem Leyendecker aus der Bergpredigt gelesen hatte, um seine Ablehnung der gleichzeitigen Auszeichnung mit "Bild"-Reportern wegen der üblen Recherchemethoden von "Bild" noch ethisch zu überhöhen, hatte sie noch eins draufgesetzt. Sie erklärte, zum Skandal würde das ganze erst dann, wenn man den Eklat nicht zum Anlass nähme zu erörtern, was unsere Kriterien für guten Journalismus und für seine Grenzen sind und bat dann alle Beteiligten "inbrünstig" genau darüber nachzudenken und sich zu engagieren. Warum verhält sie sich jetzt ganz unbeteiligt und schweigt zu Fakten, die zeigen, dass Hans Leyendecker und sein Team die journalistischen Grenzen ganz ebenso überschritten wie "Bild" und sogar noch fehlerhafter berichteten?"
Woher kam eigentlich Ihr Interesse, sich die Arbeit von dem SZ-Team genauer anzuschauen?
Hersch Fischler: "Es war die mit Superlativen gespickte Kurzlaudatio, die Anja Reschke auf der Henri Nannen Gala zu den SZ-Formel1-Beiträgen vortrug, und die ich im Web-TV live anhören konnte. Sie machte mich neugierig, das SZ-Team hätte den vermutlich größten Korruptionsfall der deutschen Wirtschaftsgeschichte ohne Whistleblower, ohne Hilfe staatsanwaltschaftlicher Ermittlungsakten, durch vertiefte eigene Recherchen selbst aufgedeckt. Ich kannte den Fall Gribkowsky nicht und las erst einmal einige der prämierten Berichte bei Sueddeutsche.de. Da fiel mir die große Nähe des Teams zur Staatsanwaltschaft auf und einiges, was in den Artikeln sehr wahrscheinlich nicht stimmte. Ich dachte mir, hier machst du mal ein Fact-Checking."
Wie sind Sie bei Ihrer Überprüfung genau vorgegangen? Wie viel Zeit braucht man für solch ein Fact-Checking?
Hersch Fischler: "Das Internet ist ein Segen für investigative Journalisten und Fact-Checker. Innerhalb von zwei Stunden hatte ich alle für das Fact-Checking relevanten Materialien auf dem Bildschirm - die eingereichten Artikel, das Rechercheprotokoll, die Jurybegründung und parallele alternative Berichterstattung, noch schneller Telefonnummern und Email-Adressen für eventuelle telefonische Nachfragen. Dann musste ich mir Gedanken über die Relevanz der verschiedenen Dokumente machen, die grundlegende Zusammenhänge nachvollziehen und dann genau lesen und Sachaussagen Satz für Satz überprüfen. Das kann dauern, aber man weiß schnell, wie weit man ist und wie viel man noch zu tun hat. Es geht ja nicht darum die Wahrheit zu ergründen, sondern festzustellen, welche wichtigen tragenden Sachaussagen belegbar falsch sind. Bald sieht man dann, ob Jurybegründungen und Berichte überhaupt noch haltbar sind. Im Falle des Henri-Nannen-Preises und der SZ-Formel1-Affäreberichte eindeutig nicht. Nach drei Tagen konnte ich das sagen und niederschreiben. Sehr hilfreich war der Recherchereport des SZ-Teams zur Formel-1-Affäre, den Hans Leyendecker als Hintergrundmaterial für eine Veranstaltung des Netzwerks Recherche zum Download auf die NR-Seiten eingestellt hatte. Selbst der enthielt grobe Fehler und Irreführungen, die aus ihm selbst dokumentierbar waren."
Herr Leyendecker hat zu NEWSROOM gesagt, dass er Sie seit Jahren kenne und Sie ein "rasender Verfolger" seien. Was meint er damit? Warum verfolgen Sie Hans Leyendecker?
Hersch Fischler: "Mit dem Journalisten Hans Leyendecker habe ich mich nach 2002 wirklich nicht mehr besonders beschäftigt. Mehr interessiert hat mich das "Netzwerk Recherche", das als Lobby für den investigativen Journalismus in der Bundesrepublik gegen Rechercheblockaden in und durch Verleger und Politiker sowie Parteien streiten wollte. Ich dachte, die könnten ein Interesse daran haben, den journalistischen Super-GAU beim "Spiegel" bei dessen Reichstagsbrand-Enthüllung aufzudecken und korrigieren zu helfen. Der damalige Vorsitzende Thomas Leif förderte diesen Versuch anfangs sogar, und lud mich ein, über meine Bertelsmann- und "Spiegel"-Recherchen einen Workshop zu machen. Das lief auch gut, aber Hans Leyendecker, der zweiter Vorsitzender aber doch eindeutig die Leitfigur des Netzwerks war, passte mein Mitwirken auf der Konferenz nicht und mein Beitrag flog dann in letzter Minute aus dem Konferenzreader heraus. Lange dachte ich, Thomas Leif habe ihn allein gekippt, weil er mit der Bertelsmann-Stiftung Kooperationsprojekte plante, aber das war wohl nicht so.
Mir fiel schnell auf, dass das "Netzwerk Recherche" von Beginn an eine Fehlkonstruktion war. Obwohl es gegen die Rechercheblockaden der Verleger, Chefredakteure, Lobbys und Parteien kämpfen sollte, finanzierte es sich überwiegend durch Sponsoring weniger großer Medienhäuser wie Gruner und Jahr, "Spiegel", "Westdeutsche Allgemeine Zeitung", "Westdeutscher Rundfunk", "Norddeutscher Rundfunk und SPD-naher Organisationen. Die Veranstaltungen zur Förderung des investigativen Journalismus wie Konferenzen und Workshops verkamen schnell zur PR für die Sponsoren und deren Hausjournalisten.
NR-Mitglieder durften sich als Elitejournalisten fühlen, aber das Interesse der überwiegenden Mehrheit der Mitglieder galt mehr den Möglichkeiten im "Netzwerk Recherche" karrierefördernde Kontakte zu machen und sich selbst PR-wirksam zu präsentieren als der Unterstützung investigativer Recherchen. Kritik an den Sponsoren, so berechtigt sie war, wurde abgewürgt. Die Rolle, die Hans Leyendecker dabei gespielt hat, habe ich bis zu seinem Ausscheiden als zweiter Vorsitzender im November letzten Jahres zu dokumentieren versucht.
Wenn der investigative Journalist Hans Leyendecker diese Versuche als rasende Verfolgung bezeichnet, kann ich darüber nur noch den Kopf schütteln."
"Die Macht, die Wut, die Medien - wo bleibt die Aufklärung?" lautet der Vortrag von Herrn Leyendecker im Rahmen einer Ringvorlesung am Otto-Suhr-Institut heute um 18 Uhr in Berlin. Wird Hans Leyendecker dort auf Ihre Recherchen eingehen?
Hersch Fischler: "Das wird sich zeigen, wenn er vorgetragen hat und Fragen gestellt werden. Zeit genug, sich Stellungnahmen zu den Vorwürfen zu überlegen, hatte er ja seit Jahren. Ich werde ihn dort jedenfalls nicht verfolgen."
Welche Lehren sollte der Journalismus aus der - wie Sie sagen - unwahren Berichterstattung in der "Süddeutschen Zeitung" ziehen?
Hersch Fischler: "Die Berichterstattung des Leyendecker-Teams zur Formel1-Affäre war nicht nur in entscheidenden Punkten unwahr, sie hat nicht nur über ihre investigativen Leistungen getäuscht, sie verrät auch eine Jagdgemeinschaft mit der Münchner Staatsanwaltschaft, dem bevorzugten staatsanwaltschaftlichen Informationszugang der SZ-Journalisten. All das hat journalistische Grenzen gesprengt. Resultat war, das Gribkowsky mit unwahren Berichten über seine erste Aussage gegenüber der Staatsanwaltschaft, in der er schon über Bernie Ecclestone als Quelle der 50 Millionen Dollar informierte, als Lügner und Gierbanker abgestempelt wurde. Andere Medien konnten diese falsche Berichterstattung nicht korrigieren, mussten sie sogar wiederholen, weil die Münchner Staatsanwaltschaft an sie aus angeblich "ermittlungstaktischen Gründen" keine Informationen herausgab. Man wird an dem Fall wahrscheinlich lernen können, dass auch investigative Journalisten mit viel Erfahrung und großer Reputation sich völlig vergaloppieren können. Fact-Checking-Abteilungen können so etwas verhindern. Wo war die Fact-Checking-Abteilung der "Süddeutschen Zeitung", die die Investigativ-Abteilung im Zaume hielt? Kluge Reden der angesehensten investigativen Journalisten allein helfen nicht. 2003, als die edlen Absichten beim "Netzwerk Recherche" noch überwogen, wusste es Hans Leyendecker noch besser: Leyendecker warf bei einer Diskussion im ARD-Hauptstadtstudio Kollegen vor, sie fühlten sich als „Verfolgungskünstler", die meinten, auf der richtigen Seite der Barriere zu stehen und andere jagen zu können. Er bezeichnete es als Kapitulation des investigativen Journalismus, wenn Journalisten immer nur Belastendes berichteten und Entlastendes ausblendeten und antwortete im gleichen Jahr dem Berliner "Tagesspiegel" auf die Frage, was mit Selbstkritik sei: "Es gibt bei uns keinen ernsthaften investigativen Journalismus. Das gilt auch für mich. Was als Enthüllungsjournalismus ausgegeben wird, ist meist nichts anderes als das Auswerten von Akten aus Ermittlungsverfahren.""
Und welche Lehren sollte die Henri-Nannen-Jury ziehen?
Hersch Fischler: "Auszeichnungen wegen guten investigativen Journalismus sollten nicht ohne vorheriges intensives Fact-Checking vergeben werden, auch nicht an Journalisten mit höchster Reputation. Qualitätsmedien werden ja von den Konsumenten immer teurer dafür bezahlt, dass sie zuverlässig auch die relevanten hintergründigen Fakten berichten, die die Konsumenten von den Nachrichtenagenturen nicht allein in Erfahrung bringen können. Ohne ein sorgfältiges Fact-Checking können Journalisten letztlich nur investigative Qualität versprechen, aber nicht liefern."
In der vergangenen Woche hat Gerhard Gribkowsky gestanden. Ist das nicht ein Erfolg für das Autoren-Trio?
Hersch Fischler: "Mit Sicherheit ist das nur ein Pyrrhussieg. Gribkowsky saß 18 Monate in U-Haft. Alle seine Mittel waren beschlagnahmt, er konnte keine guten Verteidiger mehr bezahlen, alle Medien waren völlig einseitig gegen ihn, weil sie der falschen Berichterstattung der „Süddeutschen Zeitung“ weitgehendst folgten. In seinem langen Geständnisvortrag vor Gericht sagte er praktisch das gleiche wie bei seinem ersten Gespräch mit der Staatsanwaltschaft am 29. Dezember 2010, über das Hans Leyendecker völlig falsch berichtet hatte. Seine Beratungsleistungen schilderte er aber viel weniger als damals und Bernie Ecclestone warf er nicht explizit vor, ihn bestochen zu haben. Er sagte dann lediglich, aus jetziger Sicht, also aus der Sicht auf maximal 15 Jahre Haft, ohne und sehr viel weniger mit Geständnis, erkenne er, bestechlich gewesen zu sein. Wir dürfen nicht vergessen, in der Erwartung milderer Strafen bei Geständnis, besonders nach langer U-Haft mit großen Informationsdefiziten, sind schon häufig falsche Geständnisse abgegeben worden. Soll es jetzt vorbildhaft und preiswürdig sein, dass Journalisten zusammen mit Staatsanwaltschaften vermeintliche Täter jagen, durch falsche Berichterstattung Angeklagte entwürdigen und fragwürdige, überlange U-Haft rechtfertigen helfen, und damit die Gefahr falscher Geständnisse und falscher Urteile enorm erhöhen? Diese Frage wird man nach der Henri-Nannen-Preisverleihung an Hans Leyendecker und an sein Team für die Berichterstattung zum Fall Gribkowsky diskutieren müssen. Allein sie nur zu stellen, heißt auch schon sie zu beantworten."
Mit Hersch Fischler, Publizist und Soziologe aus Düsseldorf, sprach NEWSROOM-Chefredakteur Bülend Ürük.